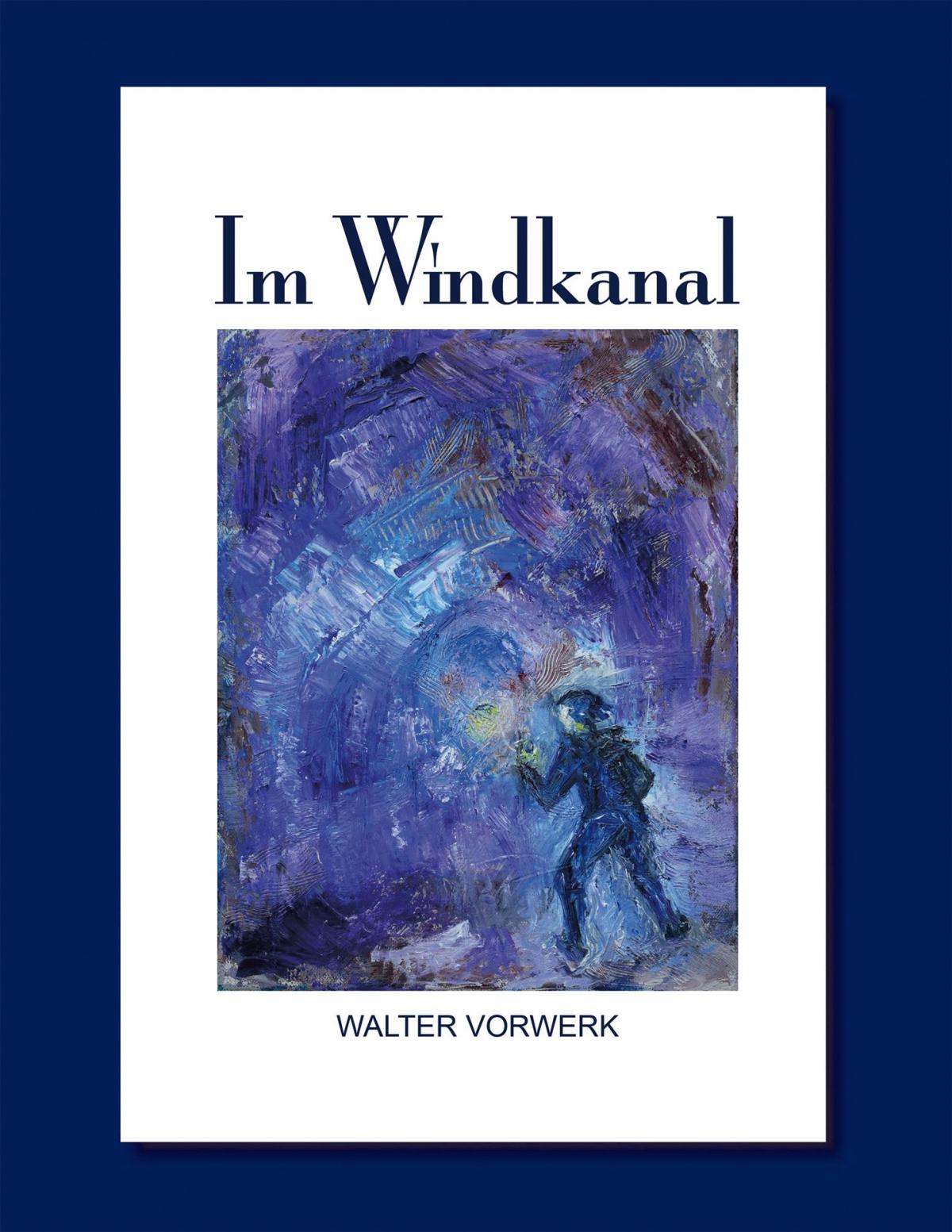Walter Vorwerk | Im Windkanal
Wenn man mein Buch zur Hand nimmt, fällt zuerst das Cover-Bild auf, ein Gemälde des 92-jährigen Greifswalder Malers Prof. Manfred Prinz. Ich hatte ihn, der eigentlich Landschaftsmaler ist, gefragt, ob er nicht Lust hätte, zu meinem Buch das Cover-Bild zu gestalten. Er sagte zu. Davor hatte ich im Internet ein wunderbares Foto eines Windkanals vom Institut für Luft- und Raumfahrt (DLR) entdeckt und dort angefragt, ob ich das Bild – natürlich unter Quellenangabe – für mein Buch verwenden könne. Es kam eine Ablehnung, weil sich das Buch nur allegorisch mit der Wirkungsweise des technischen Labors Windkanal beschäftigen würde … Nun gut, diesen Gegenwind habe ich verkraftet und dafür die jetzige Lösung gefunden.
Am Anfang stand der Buchtitel, denn es begann mit dem Sturm der Zeiten, der mir entgegenschlug und ich fühlte mich schon in sehr jungen Jahren wie eine Testfigur im Labor aerodynamischer Untersuchungen, wo die Objekte (z.B. Flugzeuge, Eisenbahnen, Autos) auf ihre aerodynamischen Eigenschaften geprüft werden, dem Luftwiderstand ausgesetzt sind – im Windkanal. Auf der Umschlag-Rückseite des Buches lesen wir:
Das Schnelllebigste ist die Zeit. Man kann sie nicht anhalten. Darin liegt die Gefahr, dass vieles vergessen wird, was wichtig erscheinen mag. Ich musste mich beeilen, dieses Buch zu schreiben, weil auch ich dieser Zeitmaschine ausgesetzt bin. Als Journalist, der in der DDR aufgewachsen ist, gehöre ich zu jener Generation im Osten, die man auch „Testgeneration“ nennen kann – daher der Titel des Buches „Im Windkanal“. Seit der einseitigen Wendezeit beschäftigt mich der missliche Umstand, dass Leute verschiedener Couleur, die die DDR gar nicht erlebt haben, glauben, „unsere Vergangenheit bewältigen“ zu können oder zu müssen. Hier schreibt ein „Ossi“ gegen das Vergessen aus seiner ganz persönlichen Erlebniswelt heraus. Vielleicht hilft das Buch, nachdenklich zu werden – das wäre mein Ziel.
Der erste Sturm erreichte mich (als Kind einer evangelischen Familie) im katholischen Kindergarten in Schlesien, wo die Erziehung nach den NS-Maßstäben von „Zucht und Ordnung“ erfolgte. Der zweite Sturm war Flucht und Vertreibung 1945 – das zentrale traumatische Erlebnis mit Sirenen, Tieffliegern, Einschlägen, Zerstörungen, Verwundeten, Toten, Gefangenen, Kälte und Hunger, der Verlust des Zuhauseseins, des Vaters … Es verfolgt mich heute noch. Dazu kommentiere ich „Im Windkanal“:
Am 12. Juni 2005 erklärte der Historiker Klaus Naumann (Jahrgang 1949), der sich speziell mit der deutschen Militärgeschichte im 2. Weltkrieg beschäftigt, in einem Kommentar im Deutschlandfunk: „Heutige Erinnerungen an die Kriegszeit sind eine Zumutung für das deutsche Volk.“ Es tut mir leid, Herr Naumann, aber ich mute dem Volk, dem ich angehöre und für das diese Kriegszeit Teil seiner Geschichte ist, zu, sich gerade heute dessen zu erinnern, wer und was uns einst in so tiefes Leid gestürzt hat und was wir einfachen Leute durchmachen mussten. Der Schleier der Vergessenheit ist wie eine Lüge. Nur wer seine Vergangenheit kennt, weiß mit der Zukunft umzugehen.
Es gibt ein Lied, das mich damals als junger Mensch entscheidend politisch motivierte – es heißt „Das neue Leben“. Text und Melodie stammen aus der Feder des jüdischen Schriftstellers Louis Fürnberg (1909-1957), dessen Lyrik ich nach wie vor sehr verehre. Er schreibt:
Fürnberg spricht mir damit völlig aus dem Herzen. Viel später lese ich, dass der Dichter und Komponist dieses Lied bereits 1936 verfasste.
Einen weiteren Sturm erlebte ich während der Studienzeit (1958-1962). Ein Mal im Jahr wurden wir Journalistik-Studenten in ein Praktikum geschickt, zumeist zu einer Betriebszeitung. Ich kam 1960 mit einer Kommilitonin in den VEB Elektromotorenwerk Dessau. „Im Windkanal“ halte ich das Erlebte fest: Es geht darum, dass ich in die Nachtschicht einer Frauenbrigade gehe und dort an einer Stanze arbeite. So lerne ich die Leute am besten kennen. „Im Windkanal“ lesen wir:
Nachdem sich Vertrauen aufgebaut hat, erzählen mir die Frauen von allerlei Sorgen im Betrieb, von nicht eingehaltenen Versprechungen bei Versorgung und Betreuung. Ich schreibe darüber und bringe das alles in den Zusammenhang mit den SED-Parteiwahlen, schließlich gehört die Betriebszeitung der Parteileitung. Mein Artikel erscheint unter der Überschrift „Sorglosigkeit und Lauheit gehören nicht in die Partei“. Kaum ist das Blättchen erschienen, werde ich zum Sekretär der SED-Betriebsparteileitung gerufen. Ich betrete sein Zimmer. Hinter einem riesigen Schreibtisch erhebt sich, die Hände aufgestützt, ein drahtiger, oberlippenbärtiger, Reitstiefel und -hosen tragender Mann und schreit mich an, dass das ganze Zimmer zittert – ich auch:Was fällt dir eigentlich ein, so einen Artikel zu schreiben. Du hast die Partei kritisiert und beschmutzt. Ich werde dafür sorge, dass du von der Universität in Leipzig relegiert wirst!“dröhnt es mir entgegen.
– Ich habe nicht die Partei kritisiert, sondern dich!
– Ich bin die Partei – raus!
Mir kommt die Wut hoch, in mir kocht es … Ich kann die Nacht nicht schlafen, wälze michvon einer Seite auf die andere und sehe mich vor dem „Gehirnwäsche-Tribunal“ des „Roten Klosters“, der Fakultät für Journalistik ...
Der Arbeitsmorgen beginnt immer mit einer Zeremonie – mit der Lektüre der SED-Zeitungen „Neues Deutschland“ und der „Freiheit“, dem Bezirksorgan der SED von Halle/Saale. Als ich die „Freiheit“ aufschlage, traue ich meinen Augen nicht – hier wird mein Artikel aus der Betriebszeitung abgedruckt. Ich nehme jubelnd die Zeitung, knalle sie dem Parteisekretär auf den Tisch und sage: So, nun kannst du mich relegieren lassen! – Relegiert wurde ich nicht, aber die Knie haben mir schon geschlottert beim Auftritt dieses „kleinen Stalin“ im Elmo-Werk Dessau 1960 …
Ab 1967 begann ich mir Notizen und Skizzen zu machen mit dem Ziel, eines Tages ein Buch zu schreiben mit dem Titel „Im Windkanal“. Es sollte eine Zeitreise durch Erlebtes, vor allem durch Unwegsamkeiten und Widerstände in meinem Leben sein.
Und die sogenannte Vorwende – und Wendezeit?
Ich hatte das Glück, an einem internationalen Russischkursus an der Moskauer Lomonossow-Universität teilnehmen zu können – Mai/Juni 1985. Im April dieses Jahres war Michail Gorbatschow neuer Partei- und Staatschef der Sowjetunion geworden. Es zog die Politik von Glasnost und Perestroika (Offenheit und Umgestaltung) ein, was wir auch in den Vorlesungen und Seminaren spürten. Es war eine unglaubliche, wunderbare Atmosphäre, die uns, die aus der dogmatischen DDR Kommenden, natürlich „versaute“.
Ein Jahr später, im November 1986, schickt man mich, um mich „auf Vordermann zu bringen“, zu einer Parteischulung ins DDR-Fernsehzentrum Adlershof. So richtig kommen die abgegriffenen Phrasen der Lektoren nicht an – der „Gorbatschow-Bazillus“ wirkte. Ich zitiere aus meinem Buch „Im Windkanal“:
Beim abschließenden Forum im Hörsaal des DDR-Fernsehens, an dem auch ein Vertreter des ZK der SED anwesend ist, wird uns zunächst „Schnee von gestern“ serviert, das Auditorium langweilt sich. Dann aber knistert es, als ein Kursteilnehmer die Frage stellt: Wir haben doch immer gesagt ‚Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen‘ – was können wir denn jetzt, bei den Zuständen in der UdSSR, überhaupt noch von Moskau lernen? Das ist der Moment, in dem es mich nicht mehr auf meinem Sitz hielt, ich bitte ums Wort und berichte vom internationalen Journalistenseminar an der Lomonossow-Universität vor einem Jahr und was die Politik Gorbatschows bedeutet. Ich ende mit dem Satz: „Wenn wir jetzt nicht anfangen, von der Sowjetunion zu lernen, dann werden wir unser blaues Wunder erleben“. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir weich in den Knien war, denn ich wusste nicht, was nach meinen Wortenpassieren würde. Jemand von der „Stasi“ könnte mich abholen oder … die Leute im Hörsaal quittieren meine kurze Rede mit frenetischem Beifall.
Am 4. November 1989 war ich mit meinem Sohn unter den über 500.000 Teilnehmern der wohl berühmtesten Demonstration in der DDR-Geschichte auf dem Alexanderplatz. Da ging es nicht um die Abschaffung der DDR, sondern um die Einhaltung der Verfassung, der Paragraphen 27 und 28, um Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Ja, es ging damals um eine „bessere DDR“ mit Freiheiten, die uns 40 Jahre lang vorenthalten worden waren.
Am 7. Februar 1990 versammelt sich die Belegschaft von „Stimme der DDR“ auf dem Korridor und beschließt, der Rundfunkstation ihren alten Namen (seit 1926) zurückzugeben – Deutschlandsender. Er geht am 12. Februar 0.00 Uhr auf Sendung und beginnt mit dem Abspielen der gesungenen Nationalhymne der DDR, in der es u.a. heißt „Deutschland, einig Vaterland“. Am nächsten Tag moderiere ich das Frühprogramm des neuen-alten Deutschlandsenders. „Im Windkanal“ halte ich fest:
Im Funkhaus herrscht große Nervosität, denn der Zug zur Einheit Deutschlands bewegt sich in rasantem Tempo. Und daraus entspringt zwangsläufig die Frage: Braucht denn dieses geeinte Deutschland den DDR-Rundfunk noch? Uns wird immer bewusster, dass eine riesige Welle der Arbeitslosigkeit auf uns zurollt. Den Leuten auf der Straße aber geht der Einheitsprozess noch zu langsam – sie ahnen ja nicht, was auf sie zukommt. Die Demagogie wächst, je mehr Parteien und Vereine entstehen, mittlerweile 45 – wer soll sich da orientieren können und zurechtfinden … Die Wahlen stehen vor der Tür. Das Schlagwort von der „Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion“ macht die Runde. Dabei ist der Hauptdreh- und Angelpunkt die einheitliche Währung – die D-Mark. Heute wissen wir, es gab keine „Union“, keine Föderation und keine Assoziation, sondern den „Anschluss nach Artikel 23 des BRD-Grundgesetzes“, das eigentlich für die DDR gar keine Gültigkeit hatte, denn das alles geschah vor und nicht nach gesamtdeutschen Wahlen. Heute fällt das vielen gar nicht mehr auf, sehr viele wissen es nicht, weil sie zu jung waren oder erst nach 1990 geboren wurden. In mein Tagebuch notiere ich:Wir gehen ungeahnten Zeiten entgegen. Auf der Strecke wird das bleiben, was wir einst als „soziale Sicherheit“ bezeichnet haben.
Während alle anderen Sender im Eiltempo aufgelöst und föderalisiert werden, die meisten Redakteure und Mitarbeiter auf die Straße fliegen, halten sich Radio DDR II und der Deutschlandsender gerade noch so über Wasser. Aber ihnen droht ebenfalls der Untergang, wenn keine einschneidende konkrete programmatische Lösung gefunden wird. Die übriggebliebenen führenden Köpfe der beiden Sender setzen sich zusammen und erkennen ihre „Schicksalsgemeinschaft“. Es wird der Plan einer Fusion geschmiedet mit dem Ziel, einen gemeinsamen Kultursender zu etablieren. Es soll den Namen„Deutschlandsender Kultur“ (DS Kultur) tragen. Anfang Mai kommt der amtierende Intendant Klaus Olizeg auf mich zu und fragt mich, ob ich die Redaktion des neu zu schaffenden Frühprogramms übernehmen würde … (ich sage zu). All die Redakteure vom Deutschlandsender und Radio DDR II, die Verantwortung übernommen haben, setzen sich zusammen und entwickeln eine Konzeption, wie unser neuer Kultursender überleben kann.
Der neue Kulturkanal beginnt am 16. Juni 1990 mit dem Sendebetrieb, ich moderiere das erste Frühprogramm „Klassisch aufstehen“. Und dann begann eine Aktion, die ihres gleichen sucht. Man verteilte Fragebögen, die jeder ausfüllen musste. Hinter der amtsdeutschen Formulierung „Strukturbereinigung nach Artikel 23 des Staatsvertrages“ verbarg sich etwas Ungeheuerliches – eine systematische Gesinnungsüberprüfung und empathielose Entlassungswelle, die rigorose Zerschlagung des DDR-Rundfunks durch vorwiegend Vertreter der alten Bundesrepublik, die nun das Sagen haben und sich willfährige Verbündete unter der „Ossis“ suchten. Es war eine skrupellose verfassungswidrige Aktion, der auch im Funkhaus beschäftigte Mütter mit Kleinkindern zum Opfer fielen. Und mit all dem war eine Verächtlichmachung der DDR verbunden, die man mit dem Synonym „Stasi“ gleichsetzte und damit die Leistungen und Biografien der Bürger der DDR herabwürdigte, was einer Demütigung gleichkommt.
Einer der westdeutschen „Abwickler“ äußerte sich einmal, dass er völlig fassungslos sei über das Intrigantentum und den Egoismus mehrerer Funkhausangehöriger, die auf diese Weise versuchten, ihr eigenes Fell zu retten, was manchem auch gelang.
Mir wird zur Last gelegt, dass ich 1975 bis 1977 auf der Baustelle der Erdgasleitung „Drushba-Trasse“ in der Ukraine politisch tätig war. Bekanntermaßen hat diese Pipeline auch Gas in die BRD geliefert. Jedenfalls war meine Arbeit damals vor 15 Jahren Grund genug für die neue Leitung, am 1. Juni 1991 mich von der Funktion als Redaktionsleiter zu entbinden. Und am 14. Juni – ich hatte gerade das Frühprogramm moderiert – werden 59 von 139 Kolleginnen und Kollegen mit Wirkung vom 1. September 1991 gekündigt – einer davon bin ich. Der Kraftfahrer bringt mir die Kündigung nach Hause ...
In meinem Buch „Im Windkanal“ heißt es:
Am 25. Juli 1991 ist meine letzte Frühprogramm-Moderation. Den Abspann, die Verabschiedung, spreche ich vorher auf Band. Ich weiß, dass ich diese Worte live nicht über meine Lippen gebracht hätte: „Bevor ich mich von Ihnen, liebe Hörer, und von diesem Sender verabschieden muss, möchte ich aus einer genialen Inschrift zitieren, die ein anonymer Verfasser 1692 in der St. Pauls Church zu Baltimore anbrachte und in der es unter anderem heißt: Was auch immer deine Arbeit und dein Sehnen ist, erhalte dir den Frieden mit deiner Seele in der lärmenden Wirrnis des Lebens. Mit all der Schande, der Plackerei und den zerbrochenen Träumen ist es dennoch eine schöne Welt.“
Unmittelbar nach der Sendung klingelt mehrfach das Telefon – solidarische Hörerinnen und Hörer rufen mich an …
Ich bin arbeitslos und reihe mich in jene Schar ein, die aufs Arbeitsamt gehen, um ihr Glück zu versuchen. Darüber verfasse ich 1991 eine Kurzgeschichte „Das Haus mit dem roten A“, in der es unter anderem heißt:
Das Warten und der Umgang mit den Leuten nervt. Die Klienten werden von Minute zu Minute gereizter. Ihre Ausgangsposition ist ja nicht gerade die beste. Sie sind eigentlich Bittsteller – ich auch. Sie fallen in jenes „schwarze Loch“, über das schon viel geschrieben und gesprochen wurde; aber, wenn’s einen selber erwischt …
Ich stehe zwischen ihnen. Dann kann ich sitzen. Zwei Stunden im vierten Stock, zwei Stunden im 6. Die Stockwerke unterscheiden sich rein äußerlich nicht, nur vom „Bearbeitungsgrad“ her, der einen hier erwartet. Im 4. beginnt man, im 6. geht’s ums Geld. Im 4. ist man noch wesentlich freundlicher, zuvorkommender. Im 6. hört „die Gemütlichkeit“ auf, da stimmen dann viele Angaben nicht mehr, weil da alles überprüft wird, in Frage gestellt wird. Kritische Bemerkungen sind hier völlig fehl am Platz, sonst erwartet sie die bissige Antwort: ‚Das müssen Sie schon uns überlassen!‘ Punktum.
Solche Art Umgang kenne ich. Ich muss mich also nicht erst umstellen. Übrigens, die ältere Dame mir gegenüber kommt mir plötzlich recht bekannt vor – früheres Wohnungsamt zu DDR-Zeiten, denke ich (Diese Wohnung ist nicht für Ihren Personenkreis …) – ja, das könnte so sein, muss aber nicht … aber der Ton, der Blick ... Ich mustere die Leute um mich herum, fange Gesprächsfetzen auf: … Der hat mich einfach gefeuert, war früher dicke da … hat einfach den Laden übernommen … Schlitzohr, Anpasser, Wendehals … Und eine Frau so um die Vierzig: Ein Superangebot war das. Der Herr war aus dem Rathaus. Ich schien ihm sympathisch zu sein. Habe schließlich auf meine Tage noch Energie im Leibe. Und dann kam der Hammer: Ja, wenn Sie in die CDU eintreten würden, dann …
Da habe ich ihn stehen lassen. Mit mir nicht mehr, so nicht! … Ich stelle fest, dass erschreckend viele junge Leute in das Haus mit dem roten „A“ kommen. Es sind auch viele Lehrer darunter und Büroleute, aber auch Produktionsarbeiter „abgewickelter“ Betriebe. Das Wort „abwickeln“ – ob das wohl der neue Einheits-Duden in seinen Schoß aufnehmen wird … Wenn sogar das österreichische Wort „Sandler“ zu finden ist. Jetzt endlich weiß ich, wovon die „Erste Allgemeine Verunsicherung“ (EAV) singt:
„Der Sandler-König Eberhard …“ – klingt ja auch besser, als der „Obdachlosenchef Eddi“. Wie groß ist eigentlich die Distanz von A zu O – vom Arbeitsamt zum Obdachlosenasyl, grübele ich nach. Ich habe ja Zeit, viel Zeit …
Da wird endlich meine Nummer aufgerufen: Die 041 bitte! Ich wundere mich, man hat „Bitte" gesagt. Und mich wundert auch, dass die Nummer 059 schon lange vor mir dran war und eben erst die 017 … alles hat seine Ordnung …
Freunde dich bloß nicht mit dem derzeitigen Zustand an … das A und O sind nicht das Arbeitsamt und das Obdachlosenasyl.
Der Chinese Sun Hongyi sagt: „Das fließende Wasser wird niemals faulig und die Scharniere der Türen werden niemals von Würmern befallen!“… Und dann geht ein Wortgespenst um in Deutschland – das Wort „Befindlichkeiten“.
Ich lasse es mir auf meiner geistigen Zunge zergehen und prüfe mein Befinden. Wo befinde ich mich? Wo finde ich mich? Wie finde ich mich? Was befindet sich wo und wie …? Wie ist mein Befinden? Ist es da nicht einfacher, man sagt gerade heraus: Wie geht es dir? oder Was geht in dir vor? Wenn man mich heute fragen würde, was typisch Deutsch sei, dann fiele mir bestimmt ein, dass wir den Hang, vielleicht auch manchmal den Drang danach haben, vieles komplizierter zu machen, als es ist – vom Ausdrücken eines Gedankens bis zum Umsetzen eines Vorhabens. Das wird im Privaten vielleicht nicht so augenscheinlich, aber in der Gesellschaft ist das unübersehbar, unüberhörbar, spürbar. Die Befindlichkeiten. Das Wort wird für alle möglichen Zustände verwendet, aber wird denn darauf Rücksicht genommen …
Als „Objekt im Windkanal“ hatte ich genügend Zeit, darüber nachzudenken. Man gab mir die Möglichkeiten dazu, man verschaffte mir die „Befindlichkeiten“. Da sind mir zum Beispiel im Haus mit den roten „A“ ein paar Verse eingefallen – diese hier:
a r b e i t s l o s
Weißt du, wie es ist,
den Gang entlang zu laufen?
Schier endloser Schierlingsbecher …
Du läufst Spießruten
in der eigenen Verbitterung.
Du bist ein Nichts.
Stamm-Nummer
für die Bürokratie,
die davon lebt,
dass es dich so gibt.
Und am Ende des Ganges?
Falltreppe oder Lift!
Wir werden uns wundern,
meinte Voltaire,
wem wir im Himmel
alles begegnen werden.
Schließlich bewerbe ich mich um eine „ABM-Stelle“ (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) – dafür wird man vorher wieder befragt, geprüft und, sollte man für „würdig befunden“ sein, zu einer Schulung geschickt. All das übernimmt eine „Servicegesellschaft Medien & Kunst GmbH“, deren Hauptgesellschafter das Westberliner Sozial-Pädagogische Institut (SPI) ist. In meinem Buch „Im Windkanal“ halte ich fest:
Es mutet makaber an, wenn man in den Schulungen gesagt bekommt, wie man mit einem Gesprächspartner umzugehen hat – und das nach über 30 Jahren Berufspraxis.
Aufschlussreich sind zwei Exkursionen der Kursteilnehmer: Die eine geht ins Volkswagenwerk nach Wolfsburg. Die andere in den einstigen DDR-Vorzeigebetrieb, in das Schwermaschinen-Kombinat „Ernst Thälmann“ (SKET) nach Magdeburg.
Größer hätte man das Kontrastprogramm nicht gestalten können. Während die riesigen pieksauberen Hallen mit automatischen Fließreihen in Wolfsburg einfach faszinieren, überkommt uns in Magdeburg große Übelkeit und Beklemmung. Wir erleben ein Beispiel für das unmoralische und inhumane Werk der „Treuhand“, wie Arbeiter unter Tränen ihre NC-gesteuerten (numerical control – Rechner gestützt) Maschinen und Geräte mit dem Schweißbrenner zu Schrott zerlegen müssen – ABM-Beschäftigte, die nach getanem Unbehagen wieder auf der Straße landen.
Und was geschieht mit mir?Da kommt etwas, was mir kalte Schauer über den Rücken jagt: ich komme zu meinem Sender „DS Kultur“, in mein Zimmer. Auf nahezu kriminelle Art verfügt die Leitung, dass ich zwar arbeiten kann, dass aber mein Name über den Sender nicht genannt werden darf. Da fragt man sich: wo bin ich denn hier eigentlich gelandet?! … Die Zügel werden später – ach, wie großzügig – gelockert. Ich darf ab und zu auch wieder moderieren und das nicht anonym. Nachdem die ABM-Zeit abgelaufen ist, liege ich wieder auf der Straße. Ich entschließe mich, etwas zu tun, was für uns Journalisten in der DDR nicht gang und gäbe war – ich beginne, als freiberuflicher Musikjournalist zu arbeiten. Dazu hatte ich mir in der ABM-Zeit ein Netz von Verbindungen aufgebaut – ich trotze dem „Windkanal“ und – bestehe. Im Jahre 2002 gehe ich in Rente – 2008 läuft im DeutschlandRadio meine letzte Sendung – ein Musikfeature.
Walter Vorwerk im Januar 2022
Bildunterschriften zu den einzelnen Klicks | B1: 16.12.1982 im Gespräch mit Kurt Masur | B2: 18.11.1989 beim Friedensforum im Interview mit einer Redakteurin Oberhessische Presse Marburg | B3: 1998 - Nachtlager des Programmsprechers Vorwerk beim MDR Kultur | Fotos: Privat
Die Herausgeberin der Zeitreisen-Webpräsenz freut sich über Zeitzeugen:innen, die peu à peu helfen, die Seiten dieses Online-Portals mit historischen Dokumenten auch weiterhin zu füllen. || Entgegen genommen werden bereits aufbereitete digitalisierte Beiträge unter Einhaltung des Datenschutzes. || Stationen der virtuellen Zeitreise